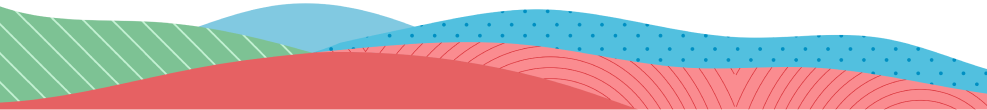Für 65 % der französischen Unternehmen ist die digitale Souveränität ein zentrales Thema (1). Der nur schwer zu definierende Begriff der „digitalen Unabhängigkeit“ gewinnt in dem Maße an Bedeutung, wie die IT-Riesen (GAFAM in den USA und BATX in China) ihre Herrschaft aufzwingen, die Nutzer immer abhängiger von ihren Lösungen machen und auf diese Weise mit den Staaten konkurrieren. Dieser Trend zur „Monokultur“ der digitalen Tools birgt jedoch sowohl strategische als auch wirtschaftliche, politische und ethische Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf die Verarbeitung der von den Nutzern gelieferten personenbezogenen Daten. Und genau hier kommt der Begriff der digitalen Souveränität ins Spiel: Sie soll den Staaten, Unternehmen und Privatpersonen ihre digitale Unabhängigkeit und die Kontrolle über ihre Daten zurückgeben. Erläuterungen.
Was versteht man unter digitaler Souveränität?
Ein souveräner Staat ist ein unabhängiger Staat, der „innerhalb seiner Grenzen von der internationalen Gemeinschaft anerkannt ist“ und frei über die „Art seiner Regierung und sein Rechtssystem“ entscheidet (2). In der digitalen Welt ist dieser Begriff jedoch nicht ganz so einfach einzugrenzen. Die digitale Souveränität bezeichnet in der Regel die Tatsache, dass ein Staat oder ein Unternehmen befugt ist, seine Vorrechte im Cyberspace wahrzunehmen, trägt aber auch konkreten Problematiken wie der technologischen Unabhängigkeit oder der Kontrolle über die personenbezogenen Daten der Nutzer Rechnung.
Aus diesem Grund hat sich die vor ca. 10 Jahren entstandene Bewegung zur Durchsetzung der digitalen Souveränität zum Ziel gesetzt, einen Teil der Befugnisse in einem digitalen Raum zurückzugewinnen, den seine Befürworter schon sehr früh als einen Bereich angesehen haben, welcher sich dem Einfluss der Staaten entzieht. Die 1996 veröffentlichte „Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace“ lehnt die Einmischung der Regierungen in dieses Ökosystem ab (3). Schon sehr bald sahen sich die Staaten in ihrer Souveränität aufgrund der rasanten digitalen Globalisierung in Frage gestellt, die sich über Grenzen und Gesetze hinwegsetzt und den Mächtigen des Internets ermöglicht, ihre eigenen Regeln aufzustellen und sich sogar in den Rang „entmaterialisierter Nationen“ zu erheben. Mehrere Beispiele belegen diese Entwicklung: die Ernennung eines Botschafters bei den GAFA durch Dänemark im Jahr 2017 (4) oder der Begriff der (zugegebenermaßen akzeptierten) „Kolonisierung“, mit dem immer häufiger die Haltung dieser multinationalen Unternehmen gegenüber „echten“ Ländern bezeichnet wird.
Das Konzept der digitalen Souveränität ist in den 2000er-Jahren aus dieser Feststellung hervorgegangen. In Frankreich wurde der Ausdruck 2008 von Pierre Bellanger in Umlauf gebracht und dann 2014 in seinem Buch „La Souveraineté numérique“ definiert, bevor er schließlich von den politischen Akteuren übernommen wurde – wie der französischen Innenministerin Michèle Alliot-Marie, die 2009 von der Notwendigkeit sprach, „die digitale Souveränität zu garantieren“ und „die Handlungskompetenz des Rechtsstaates auf den digitalen Raum auszudehnen“ (5). 2013 brachte die Snowden-Affäre (Enthüllung massiver Abhöraktionen durch die NSA) die Risiken einer fehlenden staatlichen Führung im digitalen Raum ans Licht. Und dann enthüllte 2015 der Skandal um Facebook – Cambridge Analytica die betrügerische Nutzung von personenbezogenen Daten durch die multinationalen Plattformen, die sich wenig um Datenschutz scheren. Die Frage der digitalen Unabhängigkeit ist inzwischen in aller Munde. Sie zeigt sich in konkreten, auf europäischer Ebene getroffenen Entscheidungen, die die Entwicklung souveräner Cloud-Lösungen und lokaler Suchmaschinen fördern (darunter die französische Suchmaschine Qwant), aber auch europäische Unternehmen ermutigen, sich von den großen transnationalen IT-Unternehmen unabhängig zu machen und nationale Lösungen vorzuziehen. Vor allem, wenn die von diesen Unternehmen verarbeiteten Daten als sensibel gelten – und genau hier kommen die großen Herausforderungen zum Tragen, mit denen die Unternehmen in Bezug auf die digitale Souveränität konfrontiert sind.
Welche sind die Herausforderungen der digitalen Unabhängigkeit?
Das Streben nach einer konkreten digitalen Unabhängigkeit birgt für die Unternehmen zwei große Herausforderungen, eine strategische und eine ethische.
Eine strategische Herausforderung
Da die Pandemie die Abhängigkeit der Unternehmen von transnationalen Cloud-Lösungen noch verstärkt hat, besteht heute dringender Handlungsbedarf, um eine Form der digitalen Autonomie zu entwickeln, die es den Unternehmen ermöglicht, die Kontrolle über ihre Daten (ihrer eigenen und der ihrer Kunden) zu behalten. Denn die IT-Riesen unterliegen Bestimmungen, welche mit den strategischen Interessen der Organisationen, die diese Dienste in Anspruch nehmen, im Widerspruch stehen. Die GAFAM beispielsweise unterliegen extraterritorialen Bestimmungen, wie dem „Cloud Act“, einem Gesetz, das der amerikanischen Regierung gestattet, auf die von den nationalen Unternehmen gehosteten Daten zuzugreifen … auch wenn sich deren Server außerhalb der USA befinden! Konkret heißt das, dass die Geheimhaltung dieser Daten mitnichten garantiert werden kann. Angesichts der Tatsache, dass 92 % der im Westen produzierten Daten in den USA gehostet werden (6), stellen diese Gesetze eine echte Bedrohung für die Interessen europäischer Unternehmen dar.
Eine ethische Herausforderung
Die digitale Souveränität hat auch eine Bedeutung für Einzelpersonen, denn sie zielt darauf ab, das Recht auf Schutz der Privatsphäre zu wahren. Dies ist insbesondere der Fall, wenn es sich bei den den Betreibern anvertrauten Daten um sensible Daten handelt, wie Bankdaten, Gesundheitsdaten, Finanzdaten etc.
Die extraterritorialen Bestimmungen sind jedoch nicht der alleinige Grund für diese Situation. Denn diese Daten können, nachdem sie von den Organisationen erhoben wurden, an Werbetreibende verkauft werden … oder sogar an Einrichtungen mit politischen Zielen, wie der Skandal um Cambridge Analytica gezeigt hat (die personenbezogenen Daten der Wähler wurden zur Beeinflussung des Stimmverhaltens genutzt). Da die Nutzer zunehmend auf die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten achten (69 % der Franzosen sind angesichts der Art der Nutzung beunruhigt (7)), liegt es im berechtigten Interesse der Unternehmen, ihre Informationen sorgfältig zu schützen.
Warum sollten die Unternehmen die Souveränität ihrer Daten garantieren?
Angesichts dieser Herausforderungen stellt sich die Frage, warum die Unternehmen ein berechtigtes Interesse daran haben, eine digitale Souveränität zu erlangen. Auf diese Frage gibt es mehrere Antworten.
- Um ihre Daten zu schützen. Das gilt vor allem für Unternehmen, die sensible Daten verarbeiten, in Sektoren wie Verteidigung, Gesundheit, Sicherheit, Banken und Versicherungen, Industrie etc. Nichtsdestotrotz besteht für alle personenbezogenen Daten die Gefahr, dass sie entwendet, verändert oder missbräuchlich verwendet werden. Aber, wie wir bereits gesehen haben, ist es unmöglich, ihre Geheimhaltung zu gewährleisten, solange sie von den IT-Riesen gehostet werden. Umgekehrt sind die Daten in Europa durch europäische Gesetze geschützt, wie der DSGVO.
- Um die Nutzer zu beruhigen. Die Franzosen sind sich durchaus der Problematik in Verbindung mit der Verarbeitung ihrer Daten bewusst: 49 % unter ihnen haben sich bereits gefragt, in welchem Land ihre personenbezogenen Daten gespeichert werden. 44 % neigen dazu, einem französischen oder europäischen Unternehmen in Bezug auf die Verwaltung ihrer Daten eher zu vertrauen als einem amerikanischen Unternehmen (nur 2 %!). Und schließlich erklären 66 %, dass sie bereit sind, auf einen digitalen Service zu verzichten, wenn sie nicht genau wissen, wie ihre Daten benutzt und gespeichert werden (7). Das Streben nach einer echten digitalen Unabhängigkeit wird daher zwangsläufig zu einem Differenzierungskriterium für die Unternehmen.
- Um weniger von ausländischen Lösungen abhängig zu sein sowie von den Veränderungen, die damit einher gehen könnten (im Hinblick auf ihre interne Politik oder die Anwendung nationaler Gesetzesvorschriften). Mit allen Vorteilen, die sich im Gegenzug aus der Inanspruchnahme lokaler Akteure ergeben: Kundennähe, Verständnis, Reaktionsschnelligkeit, Sicherheit.
(1) „Souveraineté numérique“, Hewlett Packard, 2020.
(2) Definition aus dem französischen Lexikon Larousse.
(3) „A Declaration of the Independence of Cyberspace“, John Perry Barlow, 1996.
(4) „Le Danemark nomme un ambassadeur auprès des GAFA“, La Tribune, 2017.
(5) „Définition et enjeux de la souveraineté numérique“, Vie Publique, 2020.
(6) „European Digital Sovereignty“, Oliver Wyman, 2020.
(7) “Les Français et la souveraineté numérique“, Ifop-Umfrage für OVHcloud, 2021.